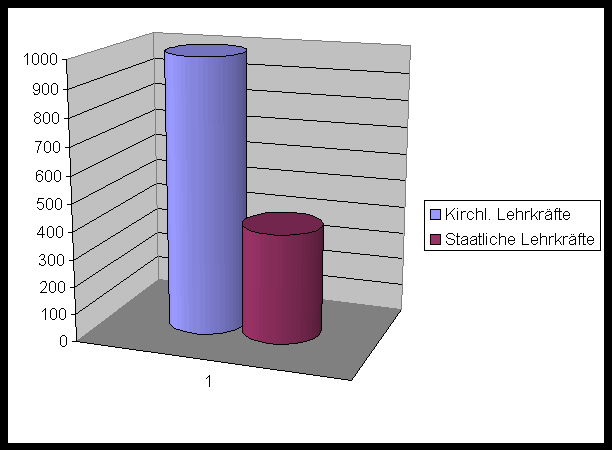
(In gekürzter Form auch erschienen in: Christenlehre / Religionsunterricht
- Praxis.
Themaheft Antijudaismus. 51 Jg. 1998, Heft 3. S. 19-21)
1. Erster gemeinsamer Erfahrungsaustausch 2. Rahmenbedingungen des Unterrichts 3. Ausgangssituation der Schüler und Lehrplan 4. Struktur der Klassen 5. Religionsunterricht in einer atheistischen Mehrheitskultur 6. Sozial-kulturelle Hintergründe: Antisemitismus und Emigration 7. Motive zur Teilnahme am Religionsunterricht 8. Didaktische Überlegungen 9. Lernziel: Religiöse Identität 10. Exodus aus der Nische der Privatreligion 11. Perspektiven jüdisch-christlicher Zusammenarbeit 12. Didaktische Impulse aus der jüdisch-christlichen Überlieferung 13. Anmerkungen
Im Rahmen der Jahresfeier der jüdisch-christlichen Arbeitsgemeinschaft
1998 in Leipzig stand das Thema des jüdischen und christlichen Religionsunterrichts
zur Diskussion.
Diese - in der Nachkriegsgeschichte Sachsens einmalige Veranstaltung -
war ein weiteres Indiz für das Wiederaufblühen des Judentums
in Deutschland. Zudem wurde deutlich, daß es zwischen jüdischem
und christlichem Religionsunterricht in Sachsen
genügend Berührungspunkte gibt, die eine zukünftige Zusammenarbeit
sinnvoll erscheinen lassen.
Rahmenbedingungen des Unterrichts
Zu Beginn der NS-Zeit (1933) wurde jeder jüdische Religionsunterricht verboten. Ab 1942 wurde jüdischen Schülern generell der Schulbesuch untersagt. Nach der Katastrophe war es zu DDR-Zeiten den jüdischen Gemeinden in Sachsen möglich, in bescheidenem, privaten Rahmen Unterricht anzubieten. Nicht alle jüdischen Kinder kamen, und unterrichtet wurde unregelmäßig. Schüler kamen, um sich auf ihre Bar Mitzwa oder Bad Mitzwa (vgl. Konfirmation) vorzubereiten. Mit dem Tod des Leipziger Religionslehrers im Jahr 1972 endet auch die Geschichte des jüdischen Unterrichts in Sachsen.
Seit 1994 arbeitet nun wieder eine Religionslehrerin für die jüdischen Gemeinden in Sachsen. Ihr Arbeitgeber - der Landesverband der jüdischen Gemeinden in Sachsen - sah, daß der Unterweisung der Kinder beim Aufbau der Gemeinden höchste Priorität zukommt. Die Religionslehrerin will nun die gesellschaftliche Nische des Privatunterrichtes der DDR-Zeit verlassen. Sie strebt nach Anerkennung ihres Unterrichts als ordentliches Schulfach. Zur Zeit hat sie 50 Schüler in fünf Klassen in Leipzig, Chemnitz und Dresden. Die Schülerzahlen steigen ständig durch das Wachstum der jüdischen Gemeinden. Neue Schüler sind auch zu erwarten, wenn ihr Unterricht zum Wahlpflichtfach für jüdische Schüler werden sollte.
Der Unterricht wird mit zwei vollen Wochenstunden erteilt. Darüber
hinaus verbringt die jüdische Religionslehrerin Wochenenden und schulfreie
Tage mit ihren Schülern. Hierbei steht ein Thema im Mittelpunkt, etwa
Schabbat oder Sukkhot. Zum Beispiel bauen die Schüler eine koschere
Sukha. Der Unterricht findet dann eine Woche lang in der Sukha statt, eben
so, wie die halakhischen Bestimmungen es vorsehen. Durch solche Projekte
und Freizeiten kann die Lehrerin ihre Schüler auf eine Weise kennenlernen,
wie es auch für den christlichen Religionsunterricht wünschenswert
wäre:
Es ist klar, daß hier staatliche Lehrer meist mehr Gelegenheiten
haben ihre Schülern auch außerhalb des Religionsunterrichtes
kennenzulernen, als externe, kirchliche Lehrkräfte. Erschwerend wirkt
weiterhin, daß - im Gegensatz zum jüdischen Religionsunterricht
- erst ab der elften Klasse in Sachsen zweistündig Religionsunterricht
erteilt wird.
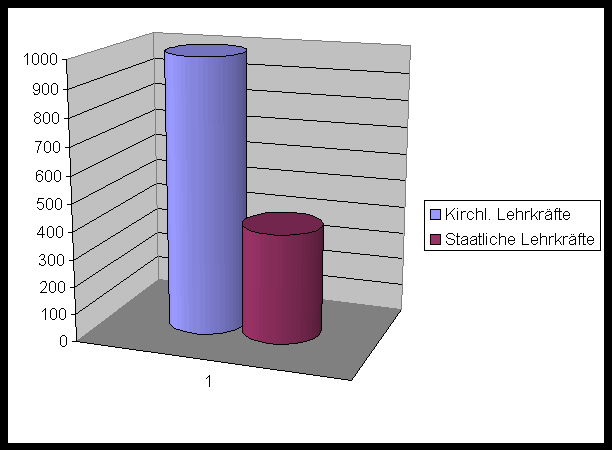
Ausgangssituation der Schüler und Lehrplan
An welche Kenntnisse und Erfahrungen von Schülern kann jüdischer Religionsunterricht in Sachsen anschließen? Bis auf wenige Ausnahmen haben diese keinerlei Kenntnisse vom Judentum: Halakha (Bestimmungen) und Aggada (Interpretationen), jüdische Feste sowie die hebräische Bibel sind weitgehend unbekannt. Analogien mit den Vorkenntnissen atheistisch erzogener Schüler im christlichen Religionsunterricht drängen sich hier auf. Auch hier hat die Lehrkraft meist von rudimentären, klischeehaften Vorstellungen vom Christentum auszugehen.
Jedoch kennt jüdischer Religionsunterricht nicht ein häufiges Problem christlichen Religionsunterrichtes, nämlich daß atheistisch und christlich erzogene Schüler in einer Klasse zu unterrichten sind (Differenzierung). Jüdischer Religionsunterricht kann sich uneingeschränkt auf die Erschließung elementarer Grundlagen jüdischer Religiosität konzentrieren. Hierbei helfen die jüdischen Lehrpläne aus Westdeutschland nicht weiter. Sie schließen nicht an die Situation in Sachsen an und dienen nur als zusätzliche Planungskontrolle.
Auch christliche Religionslehrer in Sachsen suchen noch nach einem verbindlichen
Basiscurriculum. Das jetzige, an Württemberg angelehnte Curriculum,
wird von vielen als unzureichend erfahren. Zu wenig geht es auf die spezielle
Ausgangssituation der Schüler in Sachsen ein. Hilfreich wäre
es, wenn die Kirchen sich über einen Rahmenplan (je Klassenstufe)
einigen könnten. Wenn sie das formulierten, was für sie unbedingt
und elementar zum Christsein hinzu gehört.
Dies hat die Kirche in ihrer Geschichte immer wieder tun müssen.
Sei es, daß sie im Rahmen ihrer Mission heidnische Völker unterrichtete,
sei es, daß sie ihren eigenen "Laien" die Summe ihrer Überlieferung
näherbringen wollte. Auch Luther hat zeit seines Lebens gezeigt, auf
welche Weise die christliche Überlieferung von Eltern und Lehrkräften
elementarisiert werden kann: "Solche
Fragen mag man nehmen aus dem unsern Betbüchlein oder selbst anders
machen, bis man die ganze Summa des christlichen Verstands in zwei
Stücke als in zwei Säckchen fasse im Herzen, welches sind Glaube
und Liebe". Ein Ergebnis seiner Bemühung waren seine beiden Katechismen,
für Luther ein didaktischer Versuch, eine "Kinderlehre" der christlichen
Überlieferung zu formulieren. Daß der kleine Katechismus als
dogmatisches Lehrbuch der Kirche den Kindern eingetrichtert wurde, ist
eine andere Geschichte ...
Das Basiscurriculum, mit dem der jüdische Religionsunterricht zur
Zeit arbeitet, ist am liturgischen Jahr orientiert. Hierbei ist es wichtig
zu wissen, daß Feste im Judentum immer auch Lernfeste sind,
das heißt, durch sie können wesentliche Inhalte der eigenen
Religion erschlossen werden. Es folgen das Studium der Bibel, zentrale
Gebete des Judentums und das Gebetbuch (Siddur). Dieses stellt eine Zusammenfassung
der jüdischen Tradition dar, ähnlich
dem christlichen Katechismus. Darüber hinaus werden Basiskenntnisse
des Hebräischen vermittelt. Die Schüler, die am weitesten fortgeschritten
sind, erlernen Neuhebräisch.
Das Alter der Schüler im jüdischen Religionsunterricht reicht von 8 bis hin zu 22 Jahren. Die meisten sind jedoch zwischen 13 und 18 Jahren. Die Schüler sind Juden aus der ehemaligen Sowjetunion. Die Klassenstärke variiert zwischen 2 und13 Schülern. Weniger das unterschiedliche Alter als mehr das divergierende Auffassungsvermögen ihrer Schüler stellt den jüdischen Religionsunterricht vor Probleme. Einzelne Aufgaben, die separat an lernschwache Schüler gestellt werden, werden von diesen als ein Herausreißen aus der Lerngemeinschaft erfahren. Da die primäre Motivation der Schüler die Erfahrung von Gemeinschaft ist, werden solche differenzierten Lernangebote abgelehnt. Das Problem läßt sich mit den relativ geringen Schülerzahlen im Moment nicht durch andere Klassenstrukturen lösen.
Im christlichen Religionsunterricht stellt sich dieses Problem weniger
scharf. Zwar werden Kinder aus zwei Klassenstufen oft zu einer Religionsklasse
zusammengelegt, jedoch immer innerhalb eines Schultypes.
Religionsunterricht in einer atheistischen Mehrheitskultur
Nach Schätzung der jüdischen Religionslehrerin schickt nur
die Hälfte aller jüdischen Eltern in Sachsen ihre Kinder in den
Religionsunterricht. Christen dürfte dies erstaunen. Sie diskutieren
in Sachsen eher die Frage, in welchem Rahmen - Gemeinde oder Schule – unterrichtet
werden soll. Kaum jemand bestreitet jedoch den Sinn des Unterrichts. Es
ist interessant zu sehen, daß der Anteil der Kirchenmitgliedschaft
(20 - 30%) sich an den Schulen widerspiegelt. Lediglich 20 - 30% der Schüler
nehmen am Religionsunterricht teil. (In den alten Bundesländern verhält
es sich in etwa umgekehrt.) Am wenigsten nehmen die Schüler an den
Mittelschulen am Fach Religion teil. Besser sieht es aus an den Gymnasien.
Vermutlich deshalb, weil die Kirche in Sachsen eine (Mittelstands)kirche
ist.

Warum findet es die Hälfte aller jüdischen Eltern nicht wichtig, daß ihre Kinder die eigene religiöse Überlieferung kennenlernen? Die Ursache ist darin zu suchen, daß die zugewanderten Juden aus der ehemaligen Sowjetunion stammen. Dort wurden seit 1919 - insbesondere unter Stalin - Juden brutal unterdrückt und verfolgt. Dies führte bei vielen zur Aufgabe ihrer religiösen, an der Halakha orientierten, Lebensweise. Judesein wurde im Vielvölkerstaat Sowjetunion zur Nationalität reduziert. Der Aspekt des Religiösen entschwand, das Judesein blieb.
Zudem betont auch das Judentum den Aspekt des Volkseins. Dieser Gedanke wird im Katholizismus und noch bei Luther stärker betont als im heutigen Protestantismus. Hier dominiert durch die Betonung des Artikels der Rechtfertigung (sola fide) die Vorstellung von Kirche als einer Gemeinschaft der Gläubigen.
Jude ist man jedoch auch, ohne an Gott zu glauben oder halakhisch zu leben. Die verschiedenen Strömungen des Judentums entstehen nicht durch Auseinandersetzung um den rechten Glauben (Ortho-Doxie). Gestritten wird um das richtige Handeln (Ortho-Praxie), die rechte halakhische Praxis.
Der klassische Atheismus (Feuerbach) will dem Glauben durch wissenschaftliche Analyse seine Grundlage entziehen. Hiermit zielt er auf das Selbstverständnis der Kirche, die sich als Gemeinschaft der Gläubigen (sola fide!) versteht. Wer nicht mehr glaubt, versteht sich nicht mehr als Christ. Der Kirchenaustritt folgt. Jude bleibt man.
So haben jüdischer und christlicher Religionsunterricht beide ein
zentrales Thema, nämlich die Auseinandersetzung mit den Folgen atheistischer
Unterdrückung ihrer Religion. Aufgrund der Unterschiede in der Sowjetunion/Ostdeutschland
und der unterschiedlichen Auffassung von "Gemeinschaft/Volk" kann das Ergebnis
dieser Unterdrückung durchaus verschieden sein.
Sozial-kulturelle Hintergründe: Antisemitismus und Emigration
Als Gründe für ihre Auswanderung nennen Juden den zunehmenden Antisemitismus. Ähnlich wie im Deutschland vor der Shoa schützen auch Anpassung und Assimilation an die atheistische Kultur nicht vor massiver Benachteiligung und Verfolgung. Dies geht hin bis zu offener Gewalt gegenüber Juden, wie z. B. in Moldavien. Die Schikanen hören auch in Deutschland nicht auf, wenn die Emigranten ihre Botschaften aufsuchen müssen: Die jüdische Religionslehrerin berichtete, daß die Ukraine nur gegen Geld und mit viel Schwierigkeiten Pässe emigrierender Juden verlängere. Lettland stelle im Moment gar keine Pässe mehr an Juden aus. Die fehlenden oder ungültigen Dokumente erschweren den Umgang mit Behörden, verunsichern die jüdischen Emigranten.
Wirtschaftliche Motive treten hierbei in den Hintergrund. Es hat sich herumgesprochen, daß in Deutschland nur schwer Arbeit zu finden ist. So suchen u. a. sieben jüdische Ärzte aus dem Raum Chemnitz verzweifelt nach Arbeit. Ihre Abschlüsse werden hier nicht anerkannt. Sie sind arbeitslos wie viele jüdische Emigranten. In Israel ist die Lage ähnlich. Für Deutschland spricht indes die höhere innen- und außenpolitische Sicherheit. Auch fürchten viele ältere Juden das heiße Klima Israels. Darüber hinaus weist Deutschland - aufgrund seiner jüngsten Vergangenheit - emigrierende Juden nicht wie andere europäischen Länder an der Grenze ab. Auch daß Deutschland zum zweitwichtigsten Verbündeten Israels geworden ist, mag eine Rolle spielen.
Dennoch bleiben die Klagen über die Emigration. Das Gefühl,
"Zuhause" zu sein, stellt sich nicht ein. Notgedrungen in der Fremde zu
leben, bleibt eine bittere Erfahrung. Die Hoffnung richtet sich auf die
Kinder. Sie sollen einmal ein besseres Leben führen können als
ihre Eltern.
Motive zur Teilnahme am Religionsunterricht
Die Motive der Schüler zur Teilnahme am christlichen Religionsunterricht können innerhalb einer Klasse stark divergieren. Das Spektrum reicht von: "dem kleineren Übel" bis hin zu dem Wunsch "Christ werden zu wollen". Bisher zeigten sich die meisten atheistisch erzogenen Schüler als interessiert an ihrem neuen Fach.
Jüdische Schüler werden zum Teil von ihren Eltern geschickt,
zum anderen Teil kommen sie freiwillig. Die erste Gruppe verläßt
jedoch bald wieder den Religionsunterricht. Die Schüler, die bleiben,
äußern als Grund "weil es Spaß mache". Die Lehrerin selbst
nennt als primären Grund für die Motivation ihrer Schüler,
daß diese in einer Situation der Emigration, des Kultur- und Sprachwechsels,
eine vertraute Gemeinschaft erleben. Es gibt jedoch bei den meisten neuen
Schülern eine interessierte Offenheit gegenüber ihrem neuen Fach.
Die Diskussion um Sinn und Ziele des christlichen Religionsunterricht dauert in Sachsen an, wenn sie auch nicht mehr in der Schärfe wie nach der Wende geführt wird. Doch welche Ziele im christlichen Religionsunterricht auch verfolgt werden, die "Frage nach Gott" (Nipkow) nimmt einen zentralen Platz ein. Ganz klar, denn der Artikel von der Rechtfertigung gründet eben auf dem Glauben. Und dies hat eben zu tun mit den Einstellungen, Gesinnungen, Vorstellungen des Menschen hinsichtlich ihres Gottes.
Didaktisch ist der christliche Religionsunterricht von der Gemeindepädagogik (Christenlehre) und der vorhandenen Schulpädagogik geprägt. Alternativen zum einseitig-kognitiven Unterrichtsstil der DDR-Zeit ("Wissen vermitteln - Wissen abfragen") werden gesucht. Geschieht dies nicht, so kann etwa das Thema "Reformation" leicht zum Abfragen von Geschichtsereignissen werden. Die emotionale Seite, die Erschließung von Luthers sog. "reformatorischen Wende", als einem gefühlsmäßigen Prozeß von Angst und Befreiung bleibt dann außen vor. Ebenso wie die emotionale Seite des Glaubens (fiducia), die dem Reformator neben den Glaubensinhalten (fides) so wichtig war. Auch vom Schülerbild der DDR-Pädagogik wird weg gestrebt. Nun gilt es, die Schüler in ihren Kompetenzen, Ansichten und Vorerfahrungen ernst zu nehmen, zu begleiten und zu fördern. Zudem beeinflussen nun auch zunehmend moderne (religions)pädagogische Strömungen den Religionsunterricht. So etwa Freiarbeit oder die Symboldidaktik, ganz zu schweigen von den Veränderungen, die die moderne Informationstechnologie ("Schulen ans Netz") mit sich bringt.
Im jüdischen Religionsunterricht liegt der inhaltliche Schwerpunkt nicht bei der "Frage nach Gott". Zwar ist "Glauben" ein urjüdisches Konzept (Abraham), doch kommt ihm nicht die zentrale Bedeutung wie im christlichen Religionsunterricht zu. Dennoch, auch jüdischer Religionsunterricht muß nach Alternativen zum oft noch einseitig-kognitiven Unterrichtsstil an vielen Schulen suchen. Denn das Judentum sieht den Zweck des Lernens nicht in "Wissensvermittlung", sondern in der Veränderung des Tuns der Schüler: "Nicht die Lehre ist die Hauptsache, sondern die Tat". Erinnert wird an die Übergabe der Thora am Fuß des Berges Sinai, wo Israel versprach: "Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören" (Ex 24,7). Wissen, Weisheit, Erkenntnis werden dem menschlichen Handeln unterstellt: "Jeder, dessen Taten umfangreicher sind als seine Weisheit, dessen Weisheit wird sich behaupten. Aber jeder, dessen Weisheit umfangreicher ist als seine Taten, dessen Weisheit wird sich nicht behaupten".
Jüdischer Religionsunterricht hat als Ziel die Hinführung zur Praxis des jüdischen Lebens. Dieses Ziel soll mit einer spielerisch-handlungsorientierten Didaktik erreicht werden. So wird beispielsweise die Exodusgeschichte als Theater gespielt: Schüler versetzen sich in die Lage der Hebammen, überlegen Argumente gegenüber Pharao usw. Improvisationen und Schülerdeutungen erhalten großen Raum. Bei der Vorbereitung und dem Vollzug des Pessachfestes wird das Exodusgeschehen in der Festvorbereitung und der anschließenden Feier vertieft.
Für die Religionspädagogik wäre ein Erfahrungsaustausch
hier interessant. Ihre neueren Konzepte betonen zwar den emotionalen, erfahrungsbezogenen
Aspekt des Lernens, das
handlungsorientierte Lernen hat es dagegen noch schwer. Ganz anders
Luther, der ein spielerisch-handlungsorientiertes Lernen für alle
Altersstufen Zeit
seines Leben propagiert hat.
In Sachsen als (ehemaliger) Sowjetbürger erkannt zu werden, ist für viele jüdische Emigranten eine unangenehme Enthüllung. Sich darüber hinaus noch zu seinem Judesein zu bekennen, erfordert großen Mut und Selbstbewußtsein. Zum einen lebt die Erfahrung kommunistischer Unterdrückung, zum anderen sind auch in Sachsen Klischees und Vorurteile gegenüber Juden weit verbreitet. Jugendliche können an Schulen und in der Öffentlichkeit das Auftreten rechtsradikaler Altersgenossen erleben. Auch in Israel-freundlichen Kreisen existieren hinreichend Klischees von Juden, ganz zu schweigen von Religions- und Ethikbüchern: Etwa die Vorstellung von chassidischen Schülern mit passender Frisur, altpolnischer Kleidung und starker Brille, oder Juden als "Opfer", "brilliante Wissenschaftler", "hochbegabte Musiker", "geniale Geschäftsleute". Es ist klar, daß dies weder dem Selbstverständnis sächsischer Juden entspricht noch der (religiösen) Identitätsfindung der jüdischen Schüler dient! Es ist ja gerade das Ziel des Unterrichts, daß die Schüler ihr Judesein verstehen lernen und bejahen. Daß dies durchaus gelingen kann, zeigt u. a. der gelegentliche Wunsch, sich beschneiden zu lassen, um wirklich "dazu" zu gehören.
Flankierende Lernziele, wie etwa das Verbessern der deutschen Sprache, sollen das Erstarken des Selbstbewußtseins unterstützen. Und so wird - obwohl viele Schüler lieber russisch sprechen - jüdischer Religionsunterricht in deutscher Sprache erteilt. Nur bei den Erwachsenen finden sich noch Spuren von Jiddisch. Neue Schüler erhalten zunächst eine russische Bibel, später wird diese jedoch von allen in deutscher Sprache gelesen.
Ein - dem jüdischen Religionsunterricht vergleichbares - allgemeines
Lernziel für den christlichen Religionsunterricht zu formulieren,
ist zu schwierig. Die Diskussion dauert noch an. Ein vergleichbares Lernziel
- etwa "Erziehung zum Christsein" - dürfte eher im Rahmen von Christenlehre
als im Religionsunterricht anzusiedeln sein.
Exodus aus der Nische der Privatreligion
Vieles hat sich bewegt seit der Einführung des Faches Religion in Sachsen. Klagen über die Ablehnung des Faches in Schulkreisen haben abgenommen. Viele Direktoren stehen positiv hinter der Einführung des Faches. Dennoch stoßen Unterrichtende noch auf Ablehnung und Unverständnis ihrem Fach gegenüber. Zudem wünschen sich viele, daß ihr Unterricht nicht in den Eckstunden des Stundenplans untergebracht wird.
Auch in den Reihen der Christen gibt es noch Bedenken gegen den Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen. So wird inzwischen mehr Religionsunterricht als Christenlehre in Sachsen erteilt. Was geschieht mit der Christenlehre, falls der Religionsunterricht je flächendeckend zweistündig erteilt werden sollte? "Wir können die Errungenschaften der Kirche in der DDR-Zeit doch nicht so einfach aufgeben", so brachte eine Katechetin ihre Sorgen auf den Punkt.
Jüdischer Religionsunterricht strebt hingegen eindeutig weg vom Status des Privatunterrichtes, seinem Erbe aus DDR-Zeiten. Dies geht Hand in Hand mit der Anerkennung des Faches als ordentliches Schulfach. Es ist klar, daß das Lernziel "Bejahung jüdischer Identität" nicht mit einem Rückzug in eine gesellschaftliche Nische einhergehen kann. Daß es auch anders geht als in Sachsen, zeigen Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen und Bayern.
Doch ohne Anerkennung als ordentliches Schulfache werden jüdische Schüler von ihren Direktoren aufgefordert, entweder am christlichen Religionsunterricht oder am Ethikunterricht teilzunehmen. Jüdischer Religionsunterricht bleibt aus schulischer Perspektive "Privatangelegenheit".
Einige Schulleitungen bemängeln weiterhin, daß der Unterricht
(aus organisatorischen Gründen) nicht in öffentlichen Schulgebäuden
abgehalten werde. Eine Praxis, die der katholischen Kirche in den vergangenen
Jahren durchaus zugestanden wurde.
Perspektiven jüdisch-christlicher Zusammenarbeit:
Christen in Deutschland tragen eine besondere Verantwortung für die jüdische Minderheit. Doch es gibt darüber hinaus eine Reihe von Gründen, die eine Zusammenarbeit von Juden und Christen beim Aufbau ihres Religionsunterrichtes sinnvoll erscheinen lassen:
2. Beide arbeiten an der Entwicklung eines Basiscurriculums, wie es sich modellhaft in Katechismus, Siddur und der Bibel findet (Kelal, vgl. größtes Gebot).
3. Beide Religionen streben noch nach mehr Anerkennung ihres Faches an den Schulen, wie auch nach Akzeptanz bei der Mehrheit der Bevölkerung.
4. Ein gemeinsamer Aufbau des Religionsunterrichtes kann die gegenseitigen religiösen Vorurteile helfen abzubauen.
5. Beide Religionen verbindet eine gemeinsame
religiöse, didaktische Tradition. Diese wurzelt zum einen in der
hebräischen Bibel, zum anderen in der mündlichen Tradition des
Judentums bzw. des Neuen Testament. Die Rückbesinnung hierauf kann
Impulse zur Lösung gegenwärtiger Probleme des Religionsunterrichtes
geben. Einige Beispiele seien hier als Anregung zum Schluß genannt:
Aus der Unterrichtsforschung ist es bekannt, daß die Einstellung des Lehrers zu seinen Schülern und zu seinem Fach wesentlichen Einfluß auf seinen Unterricht nimmt. Auch sein Selbstverständnis als Religionslehrer beeinflußt die Weise, wie ein Lehrer unterrichtet. Beide, sowohl die jüdische als auch die christliche Überlieferung, wollen zu diesem Themenbereich ähnliche Einsichten vermitteln:
Der Unterrichtende wird in erster Linie als permanenter und lebenslanger
Schüler des Gotteswortes gesehen ("Schüler-Lehrer"):
| Er (Rabbi Jochanan) pflegte zu sagen: "Wenn Du viel göttliche Weisung gelernt hast, schreibe es dir nicht als deinen eigenen Verdienst zu, denn hierfür wurdest du geschaffen" (mAvot 2,9). | "Ein Christ ist gewiß ein Schüler, er hat im Mutterschoß angefangen zu lernen, und er lernt bis in Ewigkeit, auch ich bin mir da ganz sicher, aber ich habe es nicht gerne" (M. Luther). |
Jeder Lernende soll auch lehren ("Lehrer-Schüler"):
| "Jemand, der lernt, ohne sein Wissen an andere weiterzugeben, ist wie Myrrhe (kostbares Harz) in der Wüste" (bRosch Ha Schana 23a.). | "Ist`s aber so, daß sie [die Christen] Gottes Wort haben und von ihm gesalbet sind, so sind sie auch schuldig, dasselbige zu bekennen, lehren und auszubreiten ..." (M. Luther). |
Der Unterrichtende wird angehalten, von seinen Schülern zu lernen
(Umkehr der Lernbeziehung):
| "Viel habe ich von meinen Lehrern gelernt, mehr noch als von meinen Lehrern habe ich von meinen Kollegen gelernt, aber das Allermeiste habe ich von meinen Schülern gelernt" (bTa’anit 7a). | "Das ist ein verkehrte und ärgerliche Rede, daß die Alten sollen von den Jungen lernen und zu Narren werden, So doch natürlicher und ordentlicher Weise die Jungen von den Altern lernen sollen ... Aber hier steht`s, daß die Jungen, so sie Gottes Wort haben, sollen klüger sein denn die Alten, weil sie Gottes Wort nicht haben, und müssen alte Narren bleiben" (M. Luther). |
Der Unterricht hat in keiner gesellschaftlichen Nische, sondern öffentlich
zu geschehen:
| "... Darum ward sie (die Thora) im Freiland gegeben, in aller Öffentlichkeit, an einer Stätte, die keinem gehört, und wer sie annehmen will komme und nehme sie ... R. Jose meint, es heißt ja (Jes 45,19): "nicht im Geheimen habe ich gesprochen, nicht an einer Stätte der Finsternis..."; als ich zuerst sie gab, gab ich sie nicht im Geheimen, nicht an einer Stätte der Finsternis, nicht an einer Stätte der Dunkelheit, auch sprach ich nicht zu den Nachkommen Jakobs "Euch allein gebe ich sie." (Mekhilta d. R.I. zu Ex 19,2). | "Denn wo du siehst und hörst, daß man das Vaterunser betet und beten lernet, auch Psalmen oder geistliche Lieder singet, nach dem Wort Gottes und rechtem Glauben, Zehn Gebote und Katechismus treibet öffentlich, da wisse, daß da ein heilig christlich Volk sei" (M. Luther). |
Der Unterricht richte sich an alle Menschen, unabhängig ihrer
Überzeugungen und Zugehörigkeiten:
| Rabbi Meir lehrte: "Woher ist zu entnehmen, daß selbst ein Heide, der sich mit der Thora befasst, dem Hohepriester gleichzuachten sei? Es heißt (Lev. 18,5): Und ihr sollt wahren meine Satzungen und meine Rechte, die der Mensch üben soll, daß er in ihnen lebe. Es wird nicht gesagt, Priester Leviten oder Israeliten, sondern der Mensch. Daraus kannst du lernen, daß selbst ein Heide, der sich mit Thora befaßt, dem Hohepriester gleicht" (b Aboda Zara 3a)." ` | " `Von Zion wird das Gesetz (Thora) ausgehen und das Wort Gottes von Jerusalem' [Jes 2,3]. Das bedeutet, daß es die Völker anrühren und anziehen wird, sodaß sie zu Christus hin-strömen und lernen, natürlich das Wort“ (M. Luther) |
Die Schule ist Teil der religiösen Kultur:
| "Die Heiligkeit des Lehrhauses ist größer
als die der Synagoge (Maimonides, Hilkoth Talmud Thora 4,2-9)
"Es ist erlaubt ein Hause des Gottesdienstes in ein Haus des Lernens umzubauen, aber es ist verboten ein Haus des Lernens in ein Haus des Gottesdienstes zu verändern" (Maimonides, Hilkhot Tefillah 11.14). |
"Also sollen jetzt Fürsten und Herren auch tun, der Klöstergüter
zur Schulen wenden und viele Personen (an)stiften zum studio (lernen).
... Summa, die Schule muß das Nächste sein bei der Kirche.."
(M.
Luther) .
|
Jüdische und christliche Überlieferung sind angewiesen
auf den lebendigen Unterricht:
| "Allein um Wille der mündlichen Unterweisung (Thora) hat Gott mit Israel einen Bund geschlossen" (bTem. 14b, B Git. 60b). | "... und Evangelium eigentlich nicht Schrift, sondern mündlich Wort sein sollt, das die Schrift hervor trüge, wie Christus und die Apostel getan haben; Darum auch Christus selbst nichts geschrieben, sondern nur geredet hat, und sein Lehre nicht Schrift, sondern Evangelium, das ist eine gute Botschaft oder Verkündigung genannt hat" (M. Luther). |